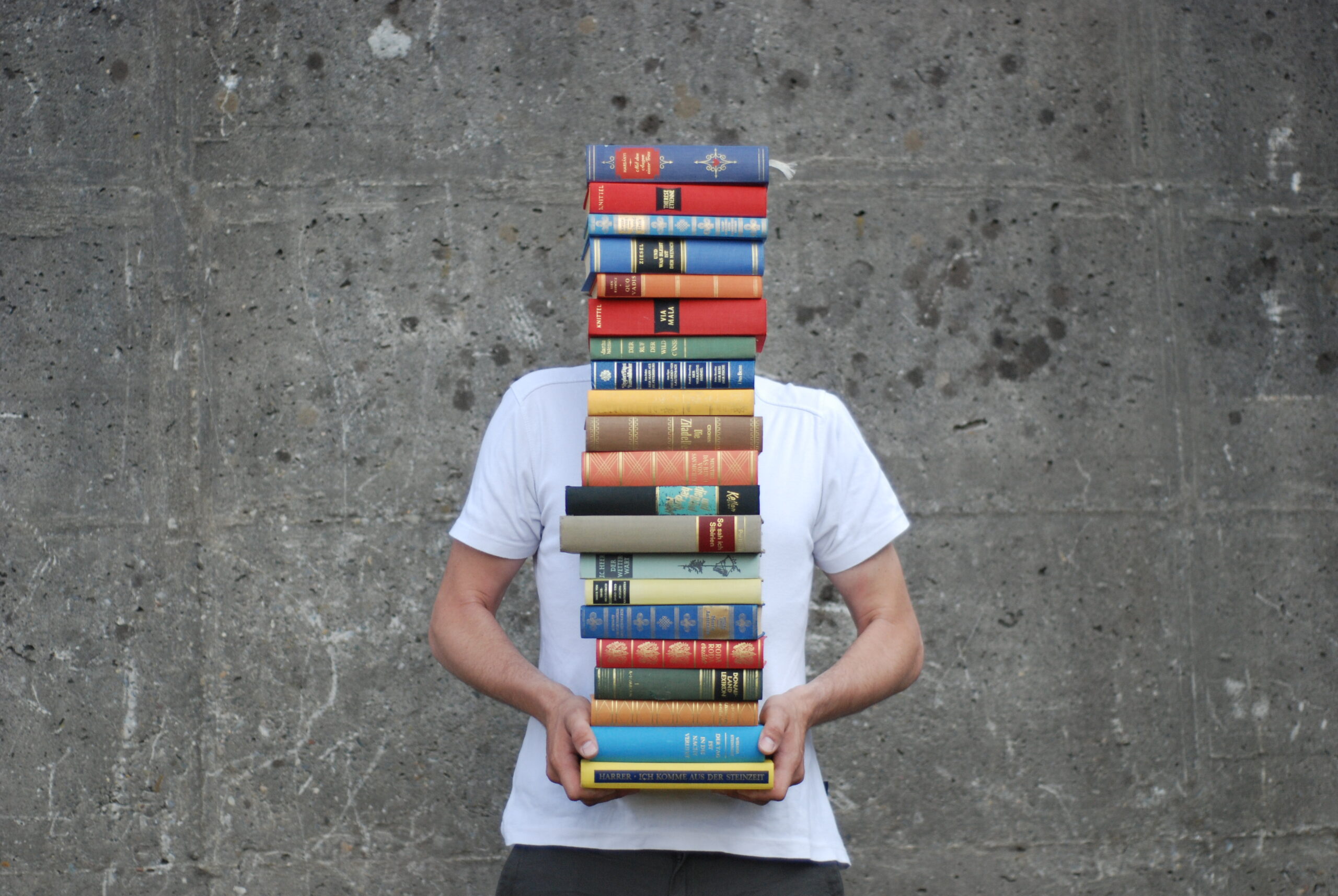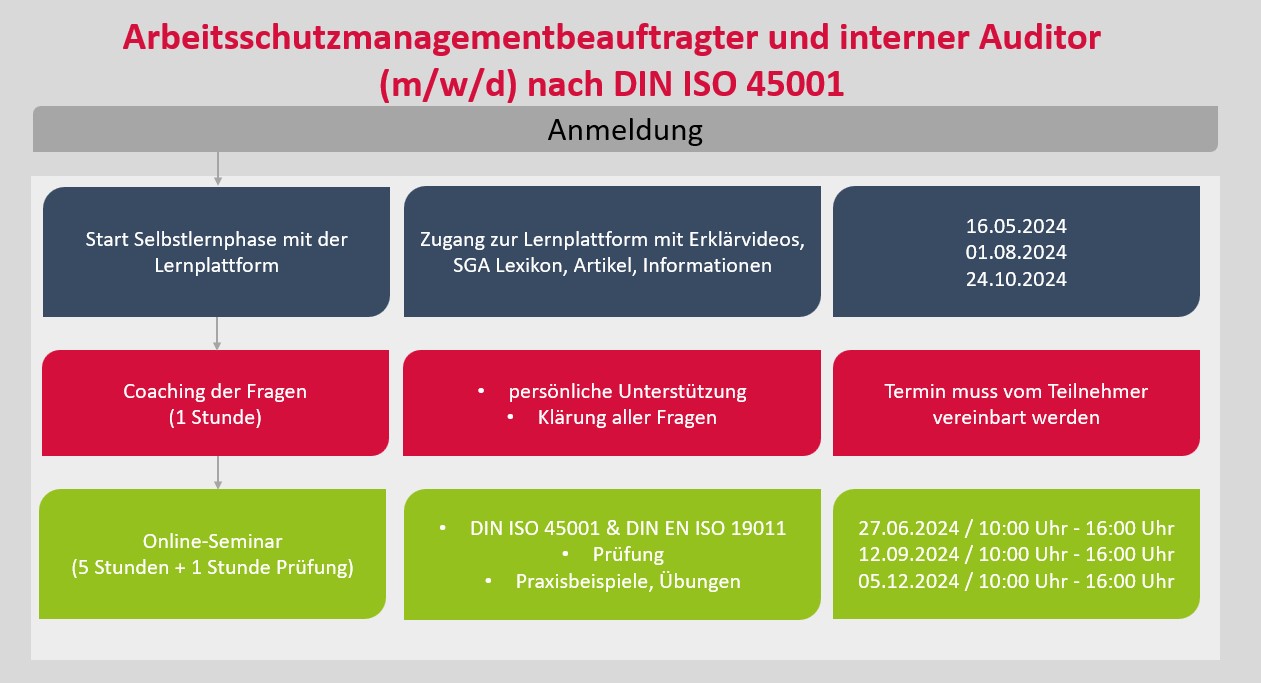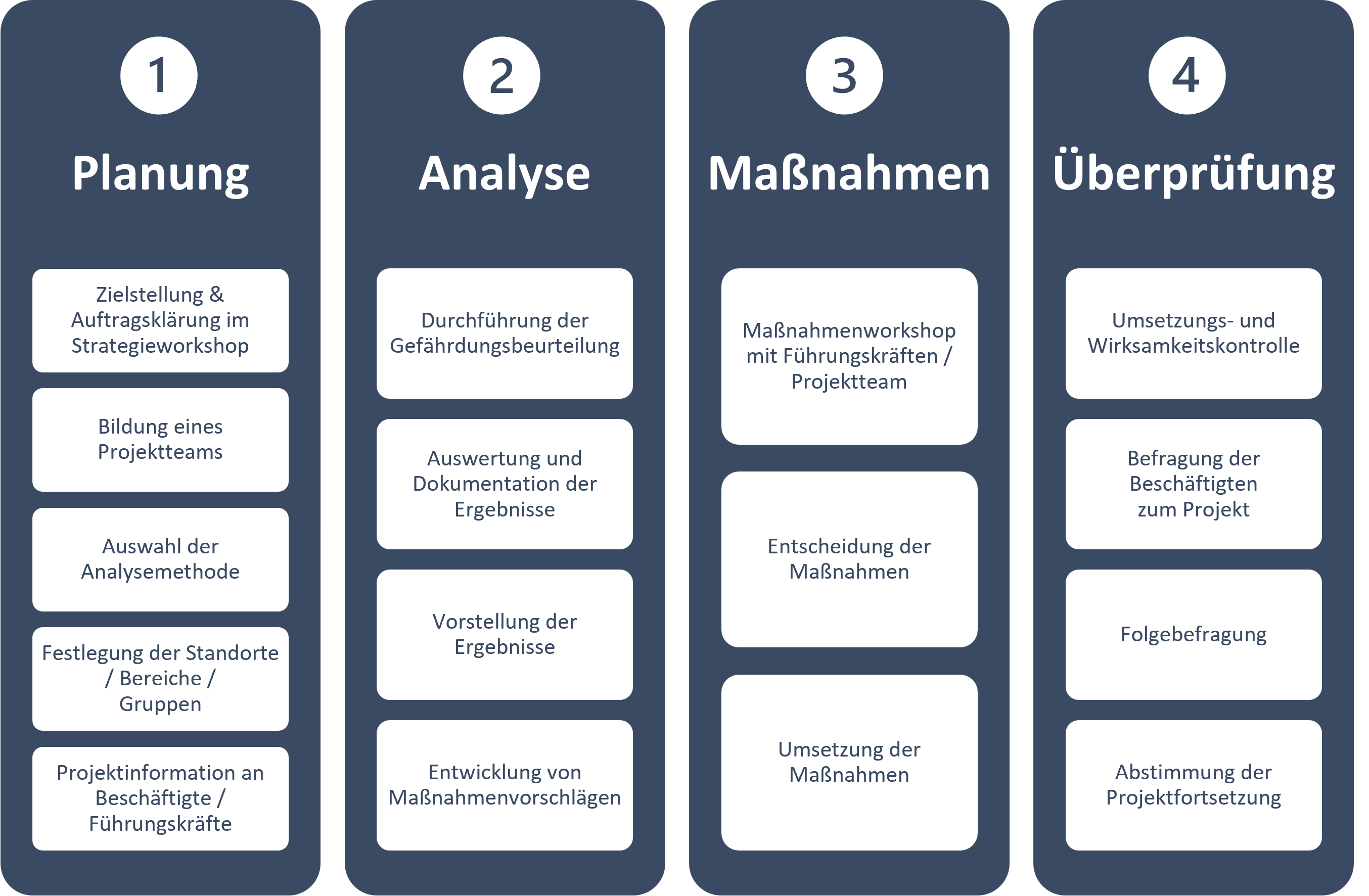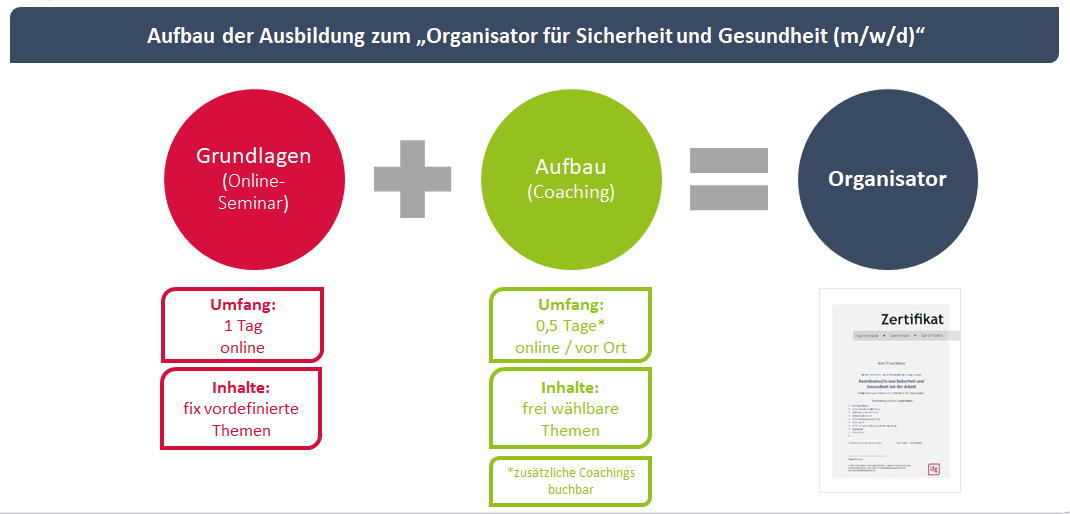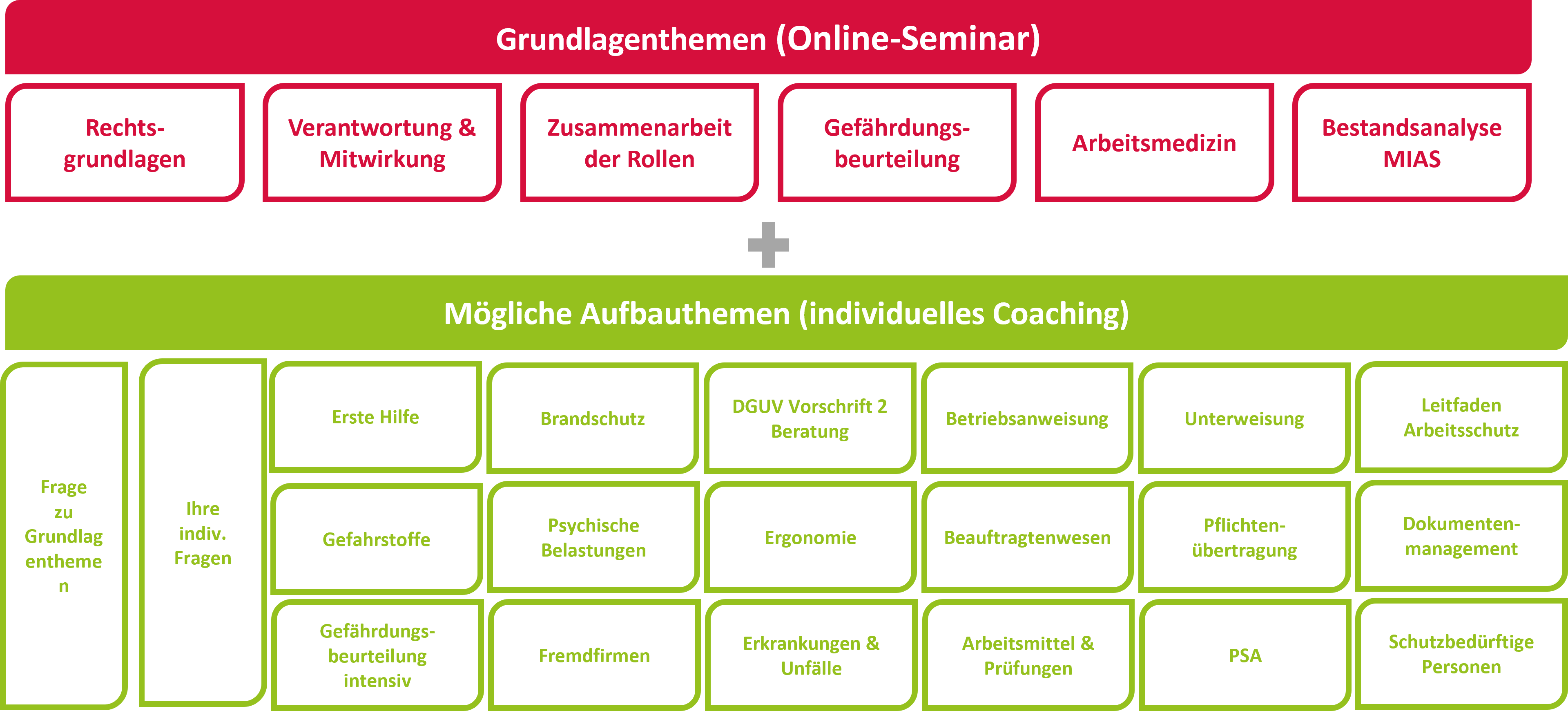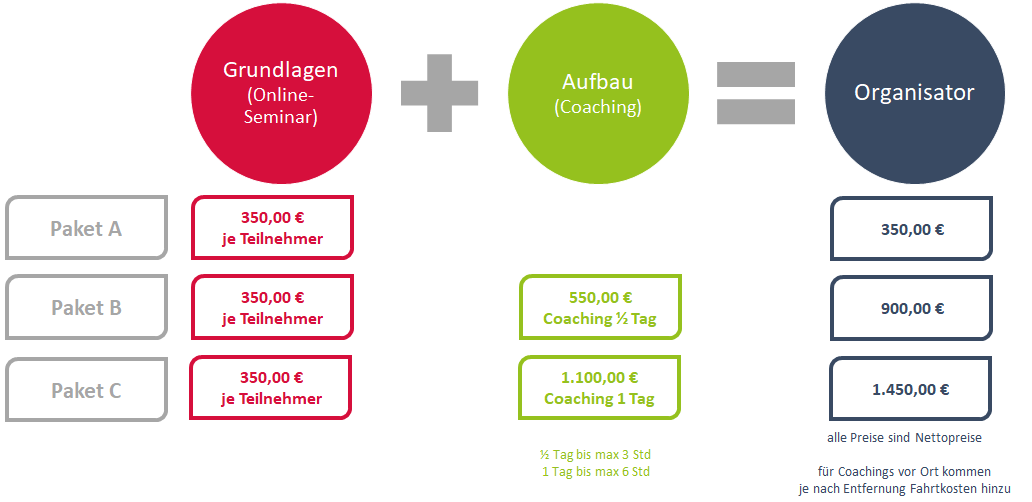Unterweisungen sind im Arbeitsschutz nicht mehr wegzudenken. Nach § 12 Arbeitsschutzgesetz sind alle Unternehmen verpflichtet Unterweisungen für ihre Beschäftigten durchzuführen. Oftmals sind die Planung sowie Umsetzung aufgrund diverser Faktoren schwierig.
Wir haben die Lösung!
Mit unserer Onlineunterweisung, deren Inhalte individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmt sind, bieten wir Ihnen ein Tool Ihre Beschäftigten nach den Kriterien der DGUV Information 211-005 zu schulen. Auf diesem Wege können Sie Ihre Angestellten dazu befähigen, sich im Betrieb sicher und gesundheitsgerecht zu verhalten.
Mittels interaktiver Inhalte, wie beispielsweise dem Einbau von Videomaterial und abschließender Lernzielkontrolle durch einen Fragebogen, ist die Onlineunterweisung eine attraktive, innovative und moderne Alternative zu konventionellen Unterweisungsmethoden. Zudem können die Unterweisungen örtlich flexibel von jedem PC aus durchgeführt werden, was enorme Vorteile der Ortsunabhängigkeit bietet.
Die genauen Inhalte zu den Themen unserer Onlineunterweisung können Sie unserer Homepage onlineunterweisung.com entnehmen.
Buchen Sie die Onlineunterweisung bis zum 31.03.2024 und erhalten Sie 30 % Rabatt im ersten Jahr!
(Code: Onlineunterweisung24)
Fordern Sie jetzt Ihr individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasstes Angebot an!